Zurück zu den Wurzeln ...
So, wie versprochen die Mittagsgedanken ...
OK, betrachten wir doch mal einen Bach, das Habitat z.B. von Caridina cf. cantonensis ... der Biotop spielt erstmal keine Rolle, da wir uns beim Thema Wasserwechsel auf die gelösten, unbelebten Inhalte konzentrieren wollen.
Machen wir es mal etwas salopper und nicht immer wissenschaftlich korrekt.
Nehmen wir mal die Gegend um 20°N, also nahe am Nördlichen Wendekreis. Das Klima ist ein küstennahes, warm gemäßigtes Klimat mit einer ausgeprägteren Trockenzeit im Winter, wärmste Monate über 22°C.
Die Küstennähe und der Chinesische Küstenstrom werden die Grenze zwischen tropischer und subtropischer Zone hier etwas zu Gunsten ersterer verschieben (5-9 humide Monate), die vorherrschende Windrichtung (mit Taifunen und Nordost- bzw. Südwestmonsun - Winter/Sommer) werden Niederschlagsmengen zwischen 1.000 und 2.000mm im langjährigen Mittel bedingen.
Unser kleiner Bach wird wohl in der Trockenzeit etwas weniger Wasser führen, dennoch garantiert das Klima in Verbindung mit den Niederschlagsmengen eine kontinuierlich Zersetzung/Lösung und schließlich Auswaschung von Nährstoffen und Mineralien.
Das heißt, dass zwar in der niederschlagsreichen Zeit mehr Nährstoffe/Mineralien ausgespült und in den Bach einsickern werden, diese aber wohl auf Grund einer erhöhten Wassermenge auch wieder entsprechend verdünnt werden. Es kann also eine annähernd gleichbleibende Konzentration angenommen werden. Vergleichende Untersuchungen in ähnlichen Klimaten können diese Annahme zumindest erhärten.
OK, wir betrachten also eine Art umgekehrten "Drive-In", der Fauna und Flora schwimmen "Currywurst-Pommes" ständig am "Mund" vorbei, zwar in geringer Konzentration (was die Untersuchungen zeigen), aber dafür im Sekundentakt.
Wer etwas braucht, bedient sich ... Stoffwechselprodukte und nicht benötigte Nährstoffe/Mineralien "verschwinden" sofort wieder aus dem Blickfeld und "belasten" das Wasser nicht, bzw. sie reichern sich eben nicht an. Deshalb ist es z.B. unerheblich, ob in dem Biotop höhere Pflanzen vorkommen oder nur Algen und Moose.
Diese Verhältnisse lassen sich auf ein Aquarium für den Hausgebrauch jedenfalls nicht übertragen.
Was machen wir zu Hause?
Wir haben unser Wasser ...
- wenn es aus der Leitung kommt, bringt es schon "irgendetwas" an Inhalt mit.
- ist es z.B. UO-Wasser, bringen wir "irgendetwas" hinein.
- gleichzeitig tragen wir auch mit dem Futter "irgendetwas" ein, denn jedes Futter enthält Spurenelemente/Mineralien/Nährstoffe - je mehr, desto besser, wenn man sich hier so manche Diskussion anschaut.
- gleichzeitig düngen wir ja auch noch fröhlich für unsere Pflanzen vor uns hin, denn denen soll es ja auch gut gehen - und der Dünger enthält auch wieder "irgendetwas" in Form von Spurenelemente/Mineralien/Nährstoffen.
- und hin und wieder wird auch noch zusätzlich mit Wasseraufbereiter und Spurenelementen, Schicki-Micki-Fit und Mongolollo-Power-Powder gearbeitet, und das bringt wieder, richtig, "irgendetwas" mit.
So, das ist die Ausgangslage - keine Kritik - wie setzt sich das alles zusammen?
- die Zusammensetzung der Dünger orientiert sich am Bedarf der submersen Pflanzen, ermittelt von der Wissenschaft und den Gärtnereien im Mittel.
- die Zusammensetzung des Futters orientiert sich (hoffentlich) am Bedarf der Tiere, natürlich auch bedingt irgendwo im Mittel.
- ebenso verhält es sich mit Spurenelementen - man hat, lapidar ausgedrückt, die Zusammensetzung von Gewässern untersucht, die Wurzel aus einem potentiellen Bedarf von Lebewesen gezogen, sich dreimal überlegt, was Sinn macht und was nicht, und stellt dies nun dem Aquarianer zur Verfügung.
Wie gesagt, keine Kritik, sondern eine Feststellung - anders wäre eine Zusammensetzung von Spurenelemente/Mineralien/Nährstoffen ohne großtechnischen Aufwand auch nicht reproduzierbar zu lösen.
OK, nun haben wir unsere "Kraftbrühe", der Tisch ist gedeckt, die Verbraucher können kommen ...
- die Bewohner werden mit Sicherheit nicht das ganze Futter "inhalieren", gerade die Garnelen schroten viel, also werden Spurenelemente/Mineralien/Nährstoffe aus dem Futter auch in Lösung gehen. Gleichzeitig wird auch ein Teil der Inhaltsstoffe wieder unverbraucht ausgeschieden werden.
- die Pflanzen nehmen sich das, was sie verarbeiten können (LIEBIG und sein olles Gesetz des Minimums), der Rest bleibt in Lösung. Wir können nicht sagen, welche Pflanzenart genau diese oder jene Verteilung mag, und wie will man das auf die Bepflanzung berechnen?
- andere "Opportunisten" wie z.B. Bakterien bedienen sich auch noch und produzieren ihrerseits wieder Stoffwechselprodukte.
So, unsere "Suppe" hat sich also verändert. Ein Teil der Stoffe wurde verarbeitet/eingelagert, sei es durch Wachstum der Pflanzen oder Garnelen, oder durch Vermehrung. Sie steht also nicht mehr frei zur Verfügung, wird so gar teilweise von uns aus dem Stoffkreislauf entfernt - sei es durch gärtnern, sei es durch das Entfernen von Leichen ("Biomasse")
Es entsteht also ein Defizit an bestimmten Stoffen, was wir wieder mit der nächsten Ladung Dünger/Spurenelemente auszugleichen versuchen. Gleichzeitig entsteht aber auch ein Suffizit bestimmter, nicht "benutzter" Stoffe, wa sich meist im Anstieg der LF oder GH bemerkbar machen kann - muß aber nicht.
Und genau diese Stoffe sind es, die mich interessieren würden bzw. die für mich der Grund für einen Wasserwechsel sind. Ich persönlich kann einfach nicht sagen bzw. mit meinen "Bordmitteln" ermessen, was sich alles im Wasser tummelt.
Es ist z.B. bekannt, dass ein Übermaß an Eisen die Pflanzen bei der Aufnahme anderer Stoffe behindert, also wie wirken sich ähnlich Verhältnisse z.B. auf Wirbellose aus? Ich weiß es nicht, da fehlen mir Einsichten, Mittel und vergleichende Arbeiten.
So, und genau das ist der Grund für einen Wasserwechsel für mich - aber immer mit Bezug und Blick auf die Art meines Beckens (Größe, Bewuchs, Fütterung, Bewohner, etc.). Dies sind alles sehr verschiedene Parameter - was kann ich also machen?
Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, ein neues Becken sowohl aufmerksam zu messen (Wasserwerte) als auch die Bewohner und den Pflanzenwuchs zu beobachten. Ich behaupte mal, man bekommt mit der Zeit ein Gespür dafür. Wenn ich also "sehe", wie sich die Wasserwerte ändern mit Bezug auf Pflanzenwachstum und Vitalität/Fertilität der Bewohner, bekomme ich ein "Gefühl" für das Verhältnis zwischen Ausgangswasser - Aufbereitung - Aquarium - Abbau.
Und dem stehen dann wieder die Bedürfnisse und die Empfindlichkeit der Bewohner gegenüber
- warum soll ich also bei unempfindlichen Pflanzen/Tieren über die Maßen wechseln (Beckengröße, Filterung, etc. vorausgesetzt)?
- warum sollte ich bei empfindlichen Tieren eben nicht dafür sorgen, dass ständig "frisches" Wasser - also ohne hohe Konzentrationen an "Stoff X" - zur Verfügung steht - und wie gestalte ich diesen Eingriff streßfrei?
Das sind für mich die beiden Grenzen, dazwischen bewege ich persönlich mich ...
Bei Odin, ich habe einen Schreibkrampf ...

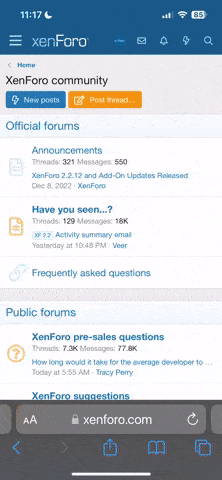


 ... die Wichtigen Filterbakterien leben ja nicht nur im Filter sondern vorallen im Bodengrund ! je nach Körung in den ersten 2-4cm Tiefe ...
... die Wichtigen Filterbakterien leben ja nicht nur im Filter sondern vorallen im Bodengrund ! je nach Körung in den ersten 2-4cm Tiefe ...