Zeit für das nächste Kapitel. Übrigens Leute: Habt ihr wirklich keine Ergänzungen oder Verbesserungsvorschläge beizusteuern? Irgendwie kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass ich nichts vergessen und dann auch noch alles in einer Punktlandung korrekt dargestellt habe.

 Wohin mit dem Aquarium? – Der richtige Standplatz
Wohin mit dem Aquarium? – Der richtige Standplatz
Bevor man in den Laden geht und sich ein Aquarium holt, sollte man sich Gedanken machen, wo das Becken später stehen soll.
Normalerweise soll ein Aquarium ja einen Blickfang im Raum darstellen, also hat man sicher schon eine Vorstellung davon, wo das Becken später stehen soll. Dieser Standplatz hat allerdings einige Anforderungen zu erfüllen:
· Je nach Beckengröße muss der Boden in der Lage sein, das Becken nebst Inhalt zu tragen. Für ein Nanobecken kein Problem, bei größeren Literzahlen sollte man vorher schauen, was möglich ist.
· Bei einem Nanobecken muss natürlich das Möbel, welches das Aquarium später tragen soll in der Lage sein, das zusätzliche Gewicht zu verkraften. Gerade bei Regalen können hier die Probleme erst mit der Zeit auftreten, wenn das Brett sich vom Gewicht durchzubiegen beginnt. Hier muss noch nicht einmal das Brett selber brechen, es kann schon reichen, wenn das Becken stellenweise hohlliegt und durch die Spannung, Glas ist nun einmal spröde, einen Spannungsriss bekommt, und sich unvermittelt mit einem leisen und ominösen „Knack“ zerlegt. Wichtig ist auch, Unebenheiten zwischen dem Aquarium und dem Untergrund auszugleichen, weshalb
eine Aquarienunterlage ein Muss darstellt. Alternativ geht auch eine Platte Styropor, aber die zumeist schwarzen Aquarienunterlagen sind nur etwa 5mm dick und verschwinden unauffällig unter dem Aqarium.
·
Ausreichend Steckdosen (mindestens 3 oder Mehrfachstecker) zum Betrieb der Technik. Auch wenn man lediglich Filter und Beleuchtung anschließen will (Heizung ist ja nicht immer erforderlich), macht eine zusätzliche Steckdose Sinn, sollte man einmal zusätzlich belüften, einen Kühlventilator anschließen oder vielleicht doch einmal heizen wollen. Wichtig ist auch, dass die Kabelführung so erfolgt, dass Wasser, welches vielleicht mal versehentlich am Kabel herunterlaufen sollte, nicht in die Steckdose gelangen kann. Hier kann man sich im Bedarfsfall mit einer Kabelschlinge behelfen, bei der eine Biegung oder Schlaufe dazu führt, dass das Wasser das Kabel wieder hinauflaufen müsste, um in die Steckdose gelangen zu können.
·
Kein direktes Sonnenlicht. Ein Trick für den erfolgreichen Aquarienbetrieb und zur Vermeidung von Algen besteht darin, dass man die „Lichtmenge“ (auch wenn der Begriff physikalisch eigentlich anders verwendet wird) passend zu den Bedürfnissen der Pflanzen und des Aquariums steuert. Dies geschieht über die Stärke der jeweiligen Lampe, und/oder über die Beleuchtungsdauer. Das geht mit einer Zeitschaltuhr sehr bequem. Dummerweise hat die Sonne keine Zeitschaltuhr. Außerdem kann direkte Sonne ein Becken auch sehr aufheizen, und es wird den Bewohnern dann gerade im Sommer unangenehm warm.
Hat man dies alles beachtet, steht dem Aufbau des Beckens nichts mehr im Wege.
Zum Thema Technik
Ein Aquarium hat die Aufgabe für seine Bewohner die Bedingungen ihres natürlichen Lebensraumes so gut als möglich zu simulieren. Hierzu bedarf es ein wenig der Aquarientechnik. Unbedingt notwendig sind eigentlich nur zwei Dinge: Licht und Filterung. Unter Umständen, das hängt vom Standort des Aquariums und dem Wärmebedürfnis seiner Bewohner ab, kann ein Heizer sinnvoll sein. Aber dazu gleich mehr.
Die Beleuchtung
Um es kurz zu machen: Pflanzen benötigen Licht, um Photosynthese betreiben und wachsen zu können. Außerdem würden wir in unserem Aquarium gerne etwas sehen (nehme ich jetzt einfach mal an).
Betrachtet man die verschiedenen Lichtquellen für ein Nano-Aquarium, so reduziert sich das Feld auf 2 ernsthafte Optionen. Prinzipiell gibt’s noch mehr Lichtquellen aber, es soll ja für den Anfang simple und vor allem praktisch sein.
Zum einen gibt es Leuchtstoffröhren und Kompaktleuchtstoffröhren, zum anderen stehen immer mehr bezahlbare Led-Lösungen zur Verfügung.
Während die Röhrensysteme oftmals günstiger in der Anschaffung sind, zeichnen sich Leds durch geringe Wärmeentwicklung, einen geringeren Stromverbrauch und eine hohe Lebensdauer aus. Aber wie bei allem gilt, dass es neben viel Licht auch viel Schatten gibt und nicht alles ist gut, nur weil Led draufsteht. Auch Angebote, die fast zu „preiswert“ sind um wahr zu sein, halten oft nicht, was sie versprechen.
Grundsätzlich ist es ratsam sich bei der Auswahl der Beleuchtung an den gewünschten Pflanzen und ihrem Lichtbedürfnis zu orientieren. Möchte man z.B. den Bodengrund des Aquariums in eine grüne Wiese verwandeln, so muss schon eine etwas kräftigere Beleuchtung her, damit am Boden des Aquariums auch genug Licht ankommt. Möchte man nur genügsame Pflanzen wie z.B. Moose pflegen, muss man nicht mega-hell auf das Aquarium braten.
Um sich vorab über die Lichtbedürfnisse zu informieren, bietet unser Nachbarforum
www.flowgrow.de eine umfangreiche und auf Wasserpflanzen spezialisierte Datenbank, um sich zu informieren und einen Eindruck vom Lichtbedarf zu bekommen. Oft findet sich auch eine zumindest ähnliche Pflanze mit geringerem Lichtbedarf, sollte man die notwendige Lichtmenge zunächst nicht in vollem Umfang bereitstellen können. Gerade bei Komplettsets hat der Hersteller im Regelfall die Lampenauswahl ja bereits getroffen und wenn man nicht umbauen oder nachrüsten möchte, muss man die Bepflanzung eben dem Lichtangebot anpassen.
Eine wichtige Größe für die Beurteilung einer Lichtquelle ist die Farbtemperatur. Sie wird in °Kelvin angegeben und ermöglicht eine Vorstellung, wie die Lichtfarbe eines Leuchtmittels wirkt. In der Aquaristik sind Lampen mit 6500-7000° Kelvin sehr verbreitet, das sie dem Farbempfinden bei Tageslicht recht nahekommen. Niedrigere Farbtemperaturen wirken dagegen oft wärmer und rötlicher, während höherer Farbtemperaturen in kalt-bläuliche spielen. Trotzdem heißt es hier aufpassen, denn oftmals sind in Herstellerbeschreibungen Lampen/Leds mit 6500° Kelvin gemeint, wenn von „kaltweiss“ die Rede ist.
Finger weg von RGB
Da wäre außerdem noch ein wichtiger Punkt: Wie es die Überschrift schon sagt, sollte man die Finger von sog. RGB-Leds lassen. Diese Leds sind zwar in der Lage aus den drei Grundfarben
Rot,
Grün und
Blau alle möglichen Farben zu mischen, und es klingt zunächst verlockend mal eben Sonnenuntergangsstimmung im Becken zu erzeugen, allerdings sind die RGBs längst so leistungsfähig, wie die rein weißen Leds. Dies liegt daran, dass in einer RGB Led genaugenommen 3 Leds (für jede Farbe eine) verbaut sind. Somit verteilt sich die Leistung auf die 3 Leds, und je nach Lichtfarbe ist der Energiegehalt auch ein anderer. Selbst wenn man die Leds mit voller Leistung die Farbe „weiß“ abstrahlen lässt, steht deutlich weniger Licht als bei einer weißen Led zur Verfügung. Auch ist das Weiß in der Regel farbstichig. Daher sollte man immer zu einer ausschließlich weißen Ledbeleuchtung als Hauptbeleuchtung greifen. Möchte man unbedingt noch mit Farbeffekten experimentieren, so ist besser zusätzlich noch eine kleinere RGB-Led zu installieren, die die Effektbeleuchtung liefert.
Die Beleuchtungsdauer
Ein wichtiger Punkt ist außerdem die Beleuchtungsdauer. Im Normalfall sind zwischen 8 und 10 Stunden Licht für ein Becken völlig ausreichend. Es hat sich außerdem bewährt, die Beleuchtungsdauer durch eine Pause zu unterbrechen. Hier wird sich viel gestritten, wie lang so eine Pause wohl sein darf/soll, aber letztendlich kann man da auch ganz pragmatisch herangehen, und die Beleuchtungszeiten so legen, dass man auch die Chance hat zuhause zu sein und sein Aquarium zu sehen, wenn das Licht an ist. So ist z.B. eine Beleuchtungsphase von 9-13 Uhr, gefolgt von einer Pause, und Fortsetzung der Beleuchtung von 17-23 Uhr eine gute Aufteilung von 10 Stunden Beleuchtungsdauer für Berufstätige, weil das Becken dann hell ist, wenn man von der Arbeit heimkommt. Um verschiedene Beleuchtungsphasen umsetzen zu können, sollte daher eine Zeitschaltuhr, am besten elektronisch, auf die Einkaufsliste gesetzt werden.

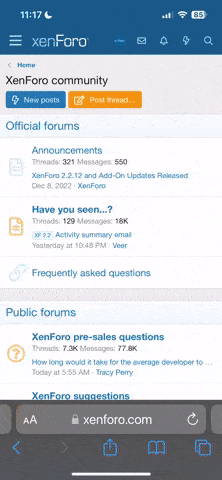






 und informativ.
und informativ.




